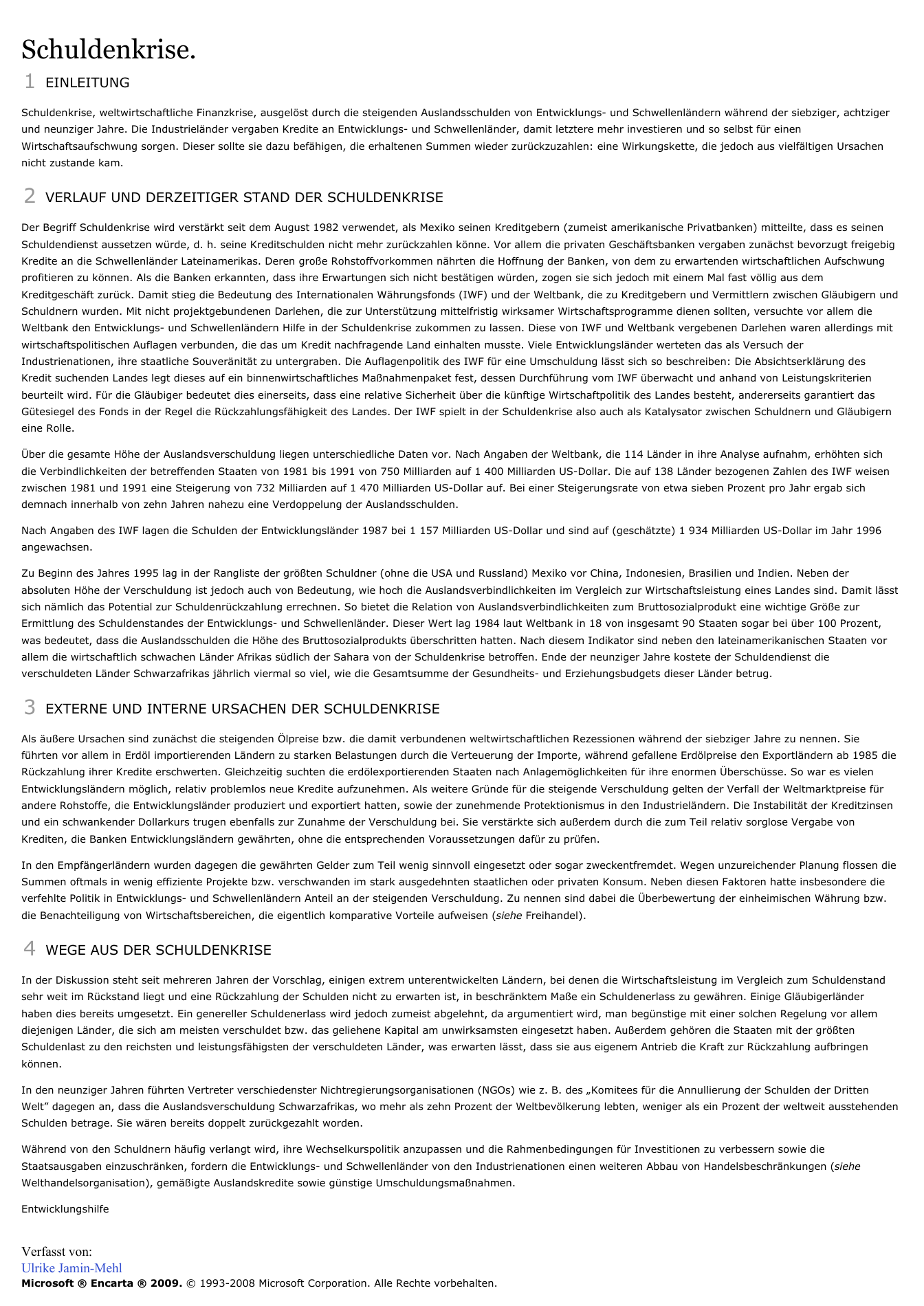Schuldenkrise.
Publié le 06/12/2021

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Schuldenkrise.. Ce document contient 1023 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
Schuldenkrise.
1
EINLEITUNG
Schuldenkrise, weltwirtschaftliche Finanzkrise, ausgelöst durch die steigenden Auslandsschulden von Entwicklungs- und Schwellenländern während der siebziger, achtziger
und neunziger Jahre. Die Industrieländer vergaben Kredite an Entwicklungs- und Schwellenländer, damit letztere mehr investieren und so selbst für einen
Wirtschaftsaufschwung sorgen. Dieser sollte sie dazu befähigen, die erhaltenen Summen wieder zurückzuzahlen: eine Wirkungskette, die jedoch aus vielfältigen Ursachen
nicht zustande kam.
2
VERLAUF UND DERZEITIGER STAND DER SCHULDENKRISE
Der Begriff Schuldenkrise wird verstärkt seit dem August 1982 verwendet, als Mexiko seinen Kreditgebern (zumeist amerikanische Privatbanken) mitteilte, dass es seinen
Schuldendienst aussetzen würde, d. h. seine Kreditschulden nicht mehr zurückzahlen könne. Vor allem die privaten Geschäftsbanken vergaben zunächst bevorzugt freigebig
Kredite an die Schwellenländer Lateinamerikas. Deren große Rohstoffvorkommen nährten die Hoffnung der Banken, von dem zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung
profitieren zu können. Als die Banken erkannten, dass ihre Erwartungen sich nicht bestätigen würden, zogen sie sich jedoch mit einem Mal fast völlig aus dem
Kreditgeschäft zurück. Damit stieg die Bedeutung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, die zu Kreditgebern und Vermittlern zwischen Gläubigern und
Schuldnern wurden. Mit nicht projektgebundenen Darlehen, die zur Unterstützung mittelfristig wirksamer Wirtschaftsprogramme dienen sollten, versuchte vor allem die
Weltbank den Entwicklungs- und Schwellenländern Hilfe in der Schuldenkrise zukommen zu lassen. Diese von IWF und Weltbank vergebenen Darlehen waren allerdings mit
wirtschaftspolitischen Auflagen verbunden, die das um Kredit nachfragende Land einhalten musste. Viele Entwicklungsländer werteten das als Versuch der
Industrienationen, ihre staatliche Souveränität zu untergraben. Die Auflagenpolitik des IWF für eine Umschuldung lässt sich so beschreiben: Die Absichtserklärung des
Kredit suchenden Landes legt dieses auf ein binnenwirtschaftliches Maßnahmenpaket fest, dessen Durchführung vom IWF überwacht und anhand von Leistungskriterien
beurteilt wird. Für die Gläubiger bedeutet dies einerseits, dass eine relative Sicherheit über die künftige Wirtschaftpolitik des Landes besteht, andererseits garantiert das
Gütesiegel des Fonds in der Regel die Rückzahlungsfähigkeit des Landes. Der IWF spielt in der Schuldenkrise also auch als Katalysator zwischen Schuldnern und Gläubigern
eine Rolle.
Über die gesamte Höhe der Auslandsverschuldung liegen unterschiedliche Daten vor. Nach Angaben der Weltbank, die 114 Länder in ihre Analyse aufnahm, erhöhten sich
die Verbindlichkeiten der betreffenden Staaten von 1981 bis 1991 von 750 Milliarden auf 1 400 Milliarden US-Dollar. Die auf 138 Länder bezogenen Zahlen des IWF weisen
zwischen 1981 und 1991 eine Steigerung von 732 Milliarden auf 1 470 Milliarden US-Dollar auf. Bei einer Steigerungsrate von etwa sieben Prozent pro Jahr ergab sich
demnach innerhalb von zehn Jahren nahezu eine Verdoppelung der Auslandsschulden.
Nach Angaben des IWF lagen die Schulden der Entwicklungsländer 1987 bei 1 157 Milliarden US-Dollar und sind auf (geschätzte) 1 934 Milliarden US-Dollar im Jahr 1996
angewachsen.
Zu Beginn des Jahres 1995 lag in der Rangliste der größten Schuldner (ohne die USA und Russland) Mexiko vor China, Indonesien, Brasilien und Indien. Neben der
absoluten Höhe der Verschuldung ist jedoch auch von Bedeutung, wie hoch die Auslandsverbindlichkeiten im Vergleich zur Wirtschaftsleistung eines Landes sind. Damit lässt
sich nämlich das Potential zur Schuldenrückzahlung errechnen. So bietet die Relation von Auslandsverbindlichkeiten zum Bruttosozialprodukt eine wichtige Größe zur
Ermittlung des Schuldenstandes der Entwicklungs- und Schwellenländer. Dieser Wert lag 1984 laut Weltbank in 18 von insgesamt 90 Staaten sogar bei über 100 Prozent,
was bedeutet, dass die Auslandsschulden die Höhe des Bruttosozialprodukts überschritten hatten. Nach diesem Indikator sind neben den lateinamerikanischen Staaten vor
allem die wirtschaftlich schwachen Länder Afrikas südlich der Sahara von der Schuldenkrise betroffen. Ende der neunziger Jahre kostete der Schuldendienst die
verschuldeten Länder Schwarzafrikas jährlich viermal so viel, wie die Gesamtsumme der Gesundheits- und Erziehungsbudgets dieser Länder betrug.
3
EXTERNE UND INTERNE URSACHEN DER SCHULDENKRISE
Als äußere Ursachen sind zunächst die steigenden Ölpreise bzw. die damit verbundenen weltwirtschaftlichen Rezessionen während der siebziger Jahre zu nennen. Sie
führten vor allem in Erdöl importierenden Ländern zu starken Belastungen durch die Verteuerung der Importe, während gefallene Erdölpreise den Exportländern ab 1985 die
Rückzahlung ihrer Kredite erschwerten. Gleichzeitig suchten die erdölexportierenden Staaten nach Anlagemöglichkeiten für ihre enormen Überschüsse. So war es vielen
Entwicklungsländern möglich, relativ problemlos neue Kredite aufzunehmen. Als weitere Gründe für die steigende Verschuldung gelten der Verfall der Weltmarktpreise für
andere Rohstoffe, die Entwicklungsländer produziert und exportiert hatten, sowie der zunehmende Protektionismus in den Industrieländern. Die Instabilität der Kreditzinsen
und ein schwankender Dollarkurs trugen ebenfalls zur Zunahme der Verschuldung bei. Sie verstärkte sich außerdem durch die zum Teil relativ sorglose Vergabe von
Krediten, die Banken Entwicklungsländern gewährten, ohne die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu prüfen.
In den Empfängerländern wurden dagegen die gewährten Gelder zum Teil wenig sinnvoll eingesetzt oder sogar zweckentfremdet. Wegen unzureichender Planung flossen die
Summen oftmals in wenig effiziente Projekte bzw. verschwanden im stark ausgedehnten staatlichen oder privaten Konsum. Neben diesen Faktoren hatte insbesondere die
verfehlte Politik in Entwicklungs- und Schwellenländern Anteil an der steigenden Verschuldung. Zu nennen sind dabei die Überbewertung der einheimischen Währung bzw.
die Benachteiligung von Wirtschaftsbereichen, die eigentlich komparative Vorteile aufweisen (siehe Freihandel).
4
WEGE AUS DER SCHULDENKRISE
In der Diskussion steht seit mehreren Jahren der Vorschlag, einigen extrem unterentwickelten Ländern, bei denen die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Schuldenstand
sehr weit im Rückstand liegt und eine Rückzahlung der Schulden nicht zu erwarten ist, in beschränktem Maße ein Schuldenerlass zu gewähren. Einige Gläubigerländer
haben dies bereits umgesetzt. Ein genereller Schuldenerlass wird jedoch zumeist abgelehnt, da argumentiert wird, man begünstige mit einer solchen Regelung vor allem
diejenigen Länder, die sich am meisten verschuldet bzw. das geliehene Kapital am unwirksamsten eingesetzt haben. Außerdem gehören die Staaten mit der größten
Schuldenlast zu den reichsten und leistungsfähigsten der verschuldeten Länder, was erwarten lässt, dass sie aus eigenem Antrieb die Kraft zur Rückzahlung aufbringen
können.
In den neunziger Jahren führten Vertreter verschiedenster Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie z. B. des ,,Komitees für die Annullierung der Schulden der Dritten
Welt" dagegen an, dass die Auslandsverschuldung Schwarzafrikas, wo mehr als zehn Prozent der Weltbevölkerung lebten, weniger als ein Prozent der weltweit ausstehenden
Schulden betrage. Sie wären bereits doppelt zurückgezahlt worden.
Während von den Schuldnern häufig verlangt wird, ihre Wechselkurspolitik anzupassen und die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern sowie die
Staatsausgaben einzuschränken, fordern die Entwicklungs- und Schwellenländer von den Industrienationen einen weiteren Abbau von Handelsbeschränkungen (siehe
Welthandelsorganisation), gemäßigte Auslandskredite sowie günstige Umschuldungsmaßnahmen.
Entwicklungshilfe
Verfasst von:
Ulrike Jamin-Mehl
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Schuldenkrise.
1
EINLEITUNG
Schuldenkrise, weltwirtschaftliche Finanzkrise, ausgelöst durch die steigenden Auslandsschulden von Entwicklungs- und Schwellenländern während der siebziger, achtziger
und neunziger Jahre. Die Industrieländer vergaben Kredite an Entwicklungs- und Schwellenländer, damit letztere mehr investieren und so selbst für einen
Wirtschaftsaufschwung sorgen. Dieser sollte sie dazu befähigen, die erhaltenen Summen wieder zurückzuzahlen: eine Wirkungskette, die jedoch aus vielfältigen Ursachen
nicht zustande kam.
2
VERLAUF UND DERZEITIGER STAND DER SCHULDENKRISE
Der Begriff Schuldenkrise wird verstärkt seit dem August 1982 verwendet, als Mexiko seinen Kreditgebern (zumeist amerikanische Privatbanken) mitteilte, dass es seinen
Schuldendienst aussetzen würde, d. h. seine Kreditschulden nicht mehr zurückzahlen könne. Vor allem die privaten Geschäftsbanken vergaben zunächst bevorzugt freigebig
Kredite an die Schwellenländer Lateinamerikas. Deren große Rohstoffvorkommen nährten die Hoffnung der Banken, von dem zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung
profitieren zu können. Als die Banken erkannten, dass ihre Erwartungen sich nicht bestätigen würden, zogen sie sich jedoch mit einem Mal fast völlig aus dem
Kreditgeschäft zurück. Damit stieg die Bedeutung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, die zu Kreditgebern und Vermittlern zwischen Gläubigern und
Schuldnern wurden. Mit nicht projektgebundenen Darlehen, die zur Unterstützung mittelfristig wirksamer Wirtschaftsprogramme dienen sollten, versuchte vor allem die
Weltbank den Entwicklungs- und Schwellenländern Hilfe in der Schuldenkrise zukommen zu lassen. Diese von IWF und Weltbank vergebenen Darlehen waren allerdings mit
wirtschaftspolitischen Auflagen verbunden, die das um Kredit nachfragende Land einhalten musste. Viele Entwicklungsländer werteten das als Versuch der
Industrienationen, ihre staatliche Souveränität zu untergraben. Die Auflagenpolitik des IWF für eine Umschuldung lässt sich so beschreiben: Die Absichtserklärung des
Kredit suchenden Landes legt dieses auf ein binnenwirtschaftliches Maßnahmenpaket fest, dessen Durchführung vom IWF überwacht und anhand von Leistungskriterien
beurteilt wird. Für die Gläubiger bedeutet dies einerseits, dass eine relative Sicherheit über die künftige Wirtschaftpolitik des Landes besteht, andererseits garantiert das
Gütesiegel des Fonds in der Regel die Rückzahlungsfähigkeit des Landes. Der IWF spielt in der Schuldenkrise also auch als Katalysator zwischen Schuldnern und Gläubigern
eine Rolle.
Über die gesamte Höhe der Auslandsverschuldung liegen unterschiedliche Daten vor. Nach Angaben der Weltbank, die 114 Länder in ihre Analyse aufnahm, erhöhten sich
die Verbindlichkeiten der betreffenden Staaten von 1981 bis 1991 von 750 Milliarden auf 1 400 Milliarden US-Dollar. Die auf 138 Länder bezogenen Zahlen des IWF weisen
zwischen 1981 und 1991 eine Steigerung von 732 Milliarden auf 1 470 Milliarden US-Dollar auf. Bei einer Steigerungsrate von etwa sieben Prozent pro Jahr ergab sich
demnach innerhalb von zehn Jahren nahezu eine Verdoppelung der Auslandsschulden.
Nach Angaben des IWF lagen die Schulden der Entwicklungsländer 1987 bei 1 157 Milliarden US-Dollar und sind auf (geschätzte) 1 934 Milliarden US-Dollar im Jahr 1996
angewachsen.
Zu Beginn des Jahres 1995 lag in der Rangliste der größten Schuldner (ohne die USA und Russland) Mexiko vor China, Indonesien, Brasilien und Indien. Neben der
absoluten Höhe der Verschuldung ist jedoch auch von Bedeutung, wie hoch die Auslandsverbindlichkeiten im Vergleich zur Wirtschaftsleistung eines Landes sind. Damit lässt
sich nämlich das Potential zur Schuldenrückzahlung errechnen. So bietet die Relation von Auslandsverbindlichkeiten zum Bruttosozialprodukt eine wichtige Größe zur
Ermittlung des Schuldenstandes der Entwicklungs- und Schwellenländer. Dieser Wert lag 1984 laut Weltbank in 18 von insgesamt 90 Staaten sogar bei über 100 Prozent,
was bedeutet, dass die Auslandsschulden die Höhe des Bruttosozialprodukts überschritten hatten. Nach diesem Indikator sind neben den lateinamerikanischen Staaten vor
allem die wirtschaftlich schwachen Länder Afrikas südlich der Sahara von der Schuldenkrise betroffen. Ende der neunziger Jahre kostete der Schuldendienst die
verschuldeten Länder Schwarzafrikas jährlich viermal so viel, wie die Gesamtsumme der Gesundheits- und Erziehungsbudgets dieser Länder betrug.
3
EXTERNE UND INTERNE URSACHEN DER SCHULDENKRISE
Als äußere Ursachen sind zunächst die steigenden Ölpreise bzw. die damit verbundenen weltwirtschaftlichen Rezessionen während der siebziger Jahre zu nennen. Sie
führten vor allem in Erdöl importierenden Ländern zu starken Belastungen durch die Verteuerung der Importe, während gefallene Erdölpreise den Exportländern ab 1985 die
Rückzahlung ihrer Kredite erschwerten. Gleichzeitig suchten die erdölexportierenden Staaten nach Anlagemöglichkeiten für ihre enormen Überschüsse. So war es vielen
Entwicklungsländern möglich, relativ problemlos neue Kredite aufzunehmen. Als weitere Gründe für die steigende Verschuldung gelten der Verfall der Weltmarktpreise für
andere Rohstoffe, die Entwicklungsländer produziert und exportiert hatten, sowie der zunehmende Protektionismus in den Industrieländern. Die Instabilität der Kreditzinsen
und ein schwankender Dollarkurs trugen ebenfalls zur Zunahme der Verschuldung bei. Sie verstärkte sich außerdem durch die zum Teil relativ sorglose Vergabe von
Krediten, die Banken Entwicklungsländern gewährten, ohne die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu prüfen.
In den Empfängerländern wurden dagegen die gewährten Gelder zum Teil wenig sinnvoll eingesetzt oder sogar zweckentfremdet. Wegen unzureichender Planung flossen die
Summen oftmals in wenig effiziente Projekte bzw. verschwanden im stark ausgedehnten staatlichen oder privaten Konsum. Neben diesen Faktoren hatte insbesondere die
verfehlte Politik in Entwicklungs- und Schwellenländern Anteil an der steigenden Verschuldung. Zu nennen sind dabei die Überbewertung der einheimischen Währung bzw.
die Benachteiligung von Wirtschaftsbereichen, die eigentlich komparative Vorteile aufweisen (siehe Freihandel).
4
WEGE AUS DER SCHULDENKRISE
In der Diskussion steht seit mehreren Jahren der Vorschlag, einigen extrem unterentwickelten Ländern, bei denen die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Schuldenstand
sehr weit im Rückstand liegt und eine Rückzahlung der Schulden nicht zu erwarten ist, in beschränktem Maße ein Schuldenerlass zu gewähren. Einige Gläubigerländer
haben dies bereits umgesetzt. Ein genereller Schuldenerlass wird jedoch zumeist abgelehnt, da argumentiert wird, man begünstige mit einer solchen Regelung vor allem
diejenigen Länder, die sich am meisten verschuldet bzw. das geliehene Kapital am unwirksamsten eingesetzt haben. Außerdem gehören die Staaten mit der größten
Schuldenlast zu den reichsten und leistungsfähigsten der verschuldeten Länder, was erwarten lässt, dass sie aus eigenem Antrieb die Kraft zur Rückzahlung aufbringen
können.
In den neunziger Jahren führten Vertreter verschiedenster Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie z. B. des ,,Komitees für die Annullierung der Schulden der Dritten
Welt" dagegen an, dass die Auslandsverschuldung Schwarzafrikas, wo mehr als zehn Prozent der Weltbevölkerung lebten, weniger als ein Prozent der weltweit ausstehenden
Schulden betrage. Sie wären bereits doppelt zurückgezahlt worden.
Während von den Schuldnern häufig verlangt wird, ihre Wechselkurspolitik anzupassen und die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern sowie die
Staatsausgaben einzuschränken, fordern die Entwicklungs- und Schwellenländer von den Industrienationen einen weiteren Abbau von Handelsbeschränkungen (siehe
Welthandelsorganisation), gemäßigte Auslandskredite sowie günstige Umschuldungsmaßnahmen.
Entwicklungshilfe
Verfasst von:
Ulrike Jamin-Mehl
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓